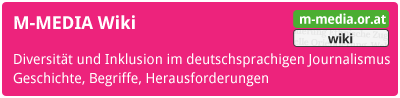Alexander Janda: „Fremdenfeindlichkeit wundert mich nicht“

- Alexander Janda ist seit 2002 Geschäftsführer des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF). Die Organisation wird zum Großteil vom Innenministerium finanziert. Der Politik- und Kommunikationswissenschaftler Janda war von 1996 bis 2000 politischer Referent in der ÖVP und danach Stabstellenleiter im ÖVP-Generalsekretariat. Im Frühjahr brachte er das Buch „Abschied von der Parallelgesellschaft“ heraus.
04.09.2012 | 19:22 | Clara Akinyosoye
Warum die Regierung an der fremdenfeindlichen Stimmung im Land schuld ist, erklärt der Geschäftsführer des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) Alexander Janda im Interview mit der „Presse“.
Die Presse: Der Titel Ihres Buchs lautet „Abschied von der Parallelgesellschaft“. Wen meinen Sie damit?
Alexander Janda: Das Wort wird meist auf migrantische Gruppen angewendet, aber auch in der Aufnahmegesellschaft gibt es Parallelgesellschaften, die nach ihren eigenen Spielregeln leben und handeln und wenig dazu beitragen, dass Integration weiterkommt. Die gibt es aber, etwa bei Medien, Parteien und NGOs.
Bleiben wir bei der Parallelwelt der politischen Parteien. Da haben Sie nur für die ÖVP Lob übrig?
Ich habe geschrieben, dass die ÖVP sich – so wie andere Parteien – lange Zeit überhaupt nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Weil sie seit 2000 das Ressort besetzt, in dem Integration angesiedelt ist, hat sie mit einer Reihe von wichtigen Schritten begonnen. Und spätestens seitdem es den Staatssekretär für Integration gibt, ist klar, welche Partei Akzente setzt.
Wie bewerten Sie die bisherige Amtszeit von Sebastian Kurz?
Die Erfolge oder Misserfolge werden wir langfristig sehen. Er nimmt jetzt Weichenstellungen vor und geht sehr sorgsam und differenziert mit dem Thema um. Die entscheidende Frage ist, wenn wir in fünf oder zehn Jahren schauen: Wohin ist dieser Zug denn gefahren?
Der Nationalratsabgeordnete Gerhard Köfer, einst SPÖ, heute bei Frank Stronach, wirft Ihnen in einer parlamentarischen Anfrage zu Ihrem Buch ÖVP-Wahlwerbung, Intransparenz in Bezug auf die Finanzen des ÖIF und mangelnde Unabhängigkeit vor.
Mich hat für dieses Buch niemand beauftragt oder es finanziert. Köfer glaubt, weil ich einmal vor zehn Jahren in der ÖVP gearbeitet habe, kann ich nicht kritisch und unabhängig denken und publizieren.
Trotz Bemühungen schneidet Österreich bei internationalen Studien meist schlecht ab, etwa beim „Migration Policy Index“. Warum?
Hier wird nur auf die Theorie, beispielsweise gesetzliche Rahmenbedingungen, geschaut. Österreich liegt auf Platz 26, Schweden auf Platz 2, obwohl die Jugendarbeitslosigkeit von Migranten dort doppelt so hoch ist. In Österreich funktioniert es wesentlich besser, als sich mit so einer Darstellung zeigen lässt.
Österreich hat auch bei der Europäischen Wertestudie sehr schlecht abgeschnitten.
Mit dem Thema müssen wir uns beschäftigen. Wir brauchen uns nicht über Fremdenfeindlichkeit wundern, wenn wir über Jahrzehnte keinerlei staatliche Informations-, Aufklärungs- und Dialogleistungen erbringen, um der Aufnahmegesellschaft sachlich zu sagen, wieso es Migration gibt und warum sie wichtig ist.
Sie glauben, wenn man die Bevölkerung mehr über die Vorteile von Zuwanderung informiert, nehmen rassistische Tendenzen ab?
Ja, aber nicht nur über die Vorteile. Wir müssen, wenn es sie gibt, auch über die Nachteile sprechen. Wir werden solche Tendenzen nicht völlig wegbringen, aber die Größenordnungen etwas verschieben können.
Ihr Buch vermittelt den Eindruck, das Integrationsproblem liege größtenteils bei türkischen Migranten und bei Muslimen.
Wenn man nach den Herkunftsländern geht, sieht man, dass Menschen türkischer Herkunft am weitesten vom statistischen Durchschnitt entfernt sind. Zumindest in Bezug auf Bildung, Teilhabe am Arbeitsmarkt, sozialen Aufstieg, Wohnversorgung.
Ist sozialer Aufstieg gleichbedeutend mit gelungener Integration?
Ich weiß nicht, ob das zu 100 Prozent gleichzusetzen ist. Aber es muss Ziel sein, jemandem, der neu in diese Gesellschaft kommt, die Möglichkeiten eines sozialen Aufstiegs zu geben. Eine schwierige Zielvorgabe. Auch für österreichische Kinder aus Nichtakademiker-Familien ist es wesentlich schwerer, einen akademischen Abschluss zu machen. Und das nach 30 Jahren freien Hochschulzugangs. Die Vererbbarkeit sozialer Aufstiegsmuster ist ein Problem. Menschen mit Migrationshintergrund sind in der Statistik tendenziell stärker in bildungsschwächeren Schichten vertreten.
Haben wir es dann nicht vielmehr mit einem Problem der Bildungspolitik als der Integrationspolitik zu tun?
Das schon bestehende österreichische Bildungsproblem, die soziale Nichtdurchlässigkeit, wird durch eine fehlende Integrationspolitik oder das fehlende Steuern bei der Gestaltung von Zuwanderungspolitik noch verstärkt.
Wie stehen Sie zur Forderung der Grünen nach einer automatischen Staatsbürgerschaft für im Inland geborene Kinder von Migranten?
Es hat mir bisher niemand erklären können, warum mit dem theoretischen Rechtsakt einer Staatsbürgerschaftsverleihung die Integration besser funktionieren soll.
Zumindest wäre es ein symbolischer Akt, diese Menschen von Anfang an als Österreicher zu definieren.
Aus meiner Sicht ist es wichtiger, die Spielregeln und Werte dieser Gesellschaft zu definieren und zu vermitteln. Das sogenannte Wirgefühl schafft man nicht mit einer symbolischen Staatsbürgerschaft.
Sie verlassen mit Ende des Jahres den ÖIF. Warum?
Weil ich dann 11 Jahre habe. Ich habe gehört, man soll alle drei bis vier Jahre den Job wechseln. (lacht)
Nur, wenn man einen neuen hat. Wohin wechseln Sie?
Darüber kann ich noch nichts sagen.
Der Wahlkampf rückt näher. Wird es eine „sachliche Debatte“ geben?
Ja, wenn Sie es mit früheren Debatten vergleichen, nein, wenn Sie von meinen persönlichen Wunschvorstellungen sprechen.
(„Die Presse“, Print-Ausgabe, 05.09.2012)