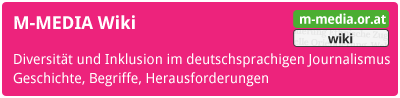Ein Iraker, der im Stephansdom singt

21.07.2009 | 17:49 | César Opazo Aravena
Gabriel Goria flüchtete als kurdischer Christ aus dem Irak, in Wien fand er Anschluss über die Musik. Aufrecht hält ihn vor allem sein christlicher Glaube, sagt er. Hier kann er ihn ausüben ohne Angst.
In wenigen Minuten beginnt das Gebet im Wiener Stephansdom, die Stunde der Barmherzigkeit. Gabriel Goria bereitet seine Stimme auf die Gesänge vor. „Wenn ich singe, mache ich meine Augen zu, denn ich weiß, dass Jesus da ist, und dieses Gefühl ist wunderschön.“ Ein Chorsänger unter vielen, und doch ist der 52-Jährige anders als die anderen: Er ist Iraker.
1980 kamen er und ein Teil seiner Familie nach Österreich. Als Flüchtling, denn Goria stammt aus einer kurdischen christlichen Familie, die im Norden des Irak, in der altmesopotamischen Stadt Ninive, lebte. „Unsere christliche Gemeinde traf sich jeden Freitagnachmittag in Bagdad. „Den Gottesdienst haben wir immer in Ruhe gefeiert“, erzählt er, nur ab und zu störten Unbekannte – moslemische Extremisten – die religiöse Feier, „aber das war nur selten“.
Erst 1979, als Saddam Hussein die Macht ergriff, begannen die Probleme: „Viele Christen wurden verfolgt. Einige Frauen wurden sogar entführt, und darum hatte ich Angst wegen meiner Schwester. Wenn ihr etwas passiert wäre, hätte ich nichts machen können.“ So beschloss er, den Irak zu verlassen – und landete in Österreich.
Nicht ohne einige Hürden: „Wir mussten eine Bestätigung bekommen, um unsere christliche Religion beweisen zu können. Wir sind hin und her gegangen, haben sie aber nicht bekommen.“ Nach langem Warten erklärten sich Vertreter der kaldäischen Kirche bereit, die erforderlichen Unterlagen bereitzustellen.
Studium und Staatsbürgerschaft
In Österreich angekommen, setzte er sein Studium der Architektur fort, machte den Abschluss und wurde 1984 österreichischer Staatsbürger. Aber nicht alles geht in seiner neuen Heimat so glatt, derzeit ist er auf Arbeitssuche.
Aufrecht hält ihn vor allem sein christlicher Glaube, sagt er. Hier kann er ihn ausüben – ohne Angst. Und hier hat er auch erst so richtig zum Glauben gefunden. Eines Tages wurde er bei einer Freundin eingeladen, deren kleiner Sohn ein Gebet vor dem Essen vorlas. „Das hat mich so berührt und dermaßen motiviert, dass ich zu Hause selbst ein Gebet geschrieben habe.“ Eines von vielen Gedichten, die er mittlerweile verfasst hat. Innig rezitiert er sein erstes Gebet: „Ich bete laut, aber auch leise und danke dir, Herr, für diese Speise, für jede Speise, die Du uns gibst. Ich bin gewiss, dass Du uns liebst. Segne diese Mahlzeit und schenke uns das Leben der Ewigkeit.“
Nach all den Traumata, der Diskriminierung im Irak, ist es Einigkeit, die dem ehemaligen Flüchtling nun besonders wichtig ist: „Mein Traum ist, die Einheit aller Christen zu erreichen. Ich will weder Katholik noch Protestant sein.“ Einen Weg zu diesem Ziel sieht er in der Musik. Musik, zu der er schon als Kind gefunden hat: „Wir sind eine musikalische Familie“, erzählt er.
Hebräische Melodien
Umso mehr freute er sich, als er vor zwei Jahren von einem Bekannten eingeladen wurde, beim Chor der Stunde der Barmherzigkeit im Stephansdom teilzunehmen. „Wir treffen uns einmal pro Monat, immer an einem Freitag. Immer zwei Stunden vor dem eigentlichen Gesang.“ Dabei werden Lieder in verschiedenen Sprachen gesungen, von Englisch, Spanisch, Deutsch bis zu Hebräisch. Besonders jene auf Hebräisch berühren ihn sehr, weil ihre Melodien der Musik ähneln, die er als Kind auf Arabisch sang. In diesen Momenten, meint er, erlebe er eine spirituelle Nähe: „Wenn ich singe, spüre ich die Anwesenheit Gottes sogar auf meiner Haut.“
Aber es ist nicht nur der spirituelle Aspekt, auch der menschliche kommt bei den regelmäßigen Treffen nicht zu kurz: „Hier habe ich wunderbare Menschen kennengelernt“, sagt er. Man fühle hier, dass Musik alle Barrieren überwinden kann.
Die neuen Termine im Stephansdom beginnen im Oktober, nach der Sommerpause – und Goria freut sich besonders darauf, weil er einige Solos auf Arabisch singen wird. Und der gebürtige Iraker meint: „Die Musik sollte die Sprache der Religionen werden.“
(„Die Presse“, Print-Ausgabe, 22.07.2009)