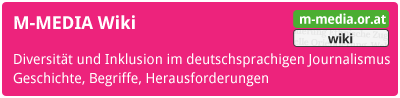Hohenems: Einst Juden, heute Türken

15.03.2009 | 19:58 | Duygu Özkan
Die kleine Vorarlberger Stadt steht exemplarisch für den Wandel von Migration und den Umgang mit Minderheiten. Statt Juden wohnen hier heute türkische Gastarbeiter.
Als der Schweizer Journalist Michael Guggenheimer 1977 Hohenems erstmalig besuchte, wollte er die jüdischen Spuren dieser kleinen Stadt in Vorarlberg rekonstruieren. Doch was er vorfand, waren verfallene Häuser, die einst die jüdische Schule oder Wohnhäuser jüdischer Kaufmänner waren. Juden selbst fand er nicht, sie wohnten hier schon lange nicht mehr. Nach der Zeit des Nationalsozialismus ist auch niemand von ihnen hierher zurückgekehrt.
Die mittlerweile schon stark maroden Häuser in der ehemaligen Israelitengasse stehen dennoch nicht leer. Heute wohnen hier Gastarbeiter, meist aus der Türkei. „Ich konnte jedoch nicht viel über die Häuser erfahren“, erinnert sich Guggenheimer, „denn damals sprach niemand Deutsch.“
Die Geschichte der Migration in Österreich lässt sich in Hohenems exemplarisch nachzeichnen: „Die jüdische Familie Rosenthal verkaufte ihr Haus an Zuwanderer aus Böhmen“, erzählt Hanno Loewy, Direktor des Jüdischen Museums Hohenems. „Später wohnte die italienische Familie Collini dort, die eine Messerschleiferei eröffnete. Noch heute gehört das Haus den Collinis, die es an ihre Arbeiter vermieten – an türkische Migranten.“
Diaspora und Akkulturation
An der Geschichte dieses Hauses könne man sehen, wie unterschiedlich und doch ähnlich Migration verläuft, so Loewy. Dementsprechend werden die verschiedenen Migrationsgeschichten im Jüdischen Museum aufgearbeitet. Wenn dort zunächst von einer jüdischen Migration die Rede ist, habe das sehr wohl aktuellen Bezug: „Wörter wie Diaspora und Akkulturation werden zwar im jüdischen Kontext wiedergegeben, doch die Besucher stellen einen Bezug zur Gegenwart her“, so Loewy, „sie bringen die Welt von heute im Kopf mit.“ Trotzdem wird im Museum nicht nur jüdische Migration thematisiert. 2004 wurde hier die Ausstellung „Lange Zeit in Österreich“ gezeigt, eine Erinnerung an die Gastarbeiter, die letztendlich zu Zugewanderten geworden sind.
„Jüdische Museen sind zwar geeignet, um Migrationsgeschichte zu behandeln“, sagt Michael Guggenheimer, „doch viel dringender wäre die Etablierung eines Migrationsmuseums.“ Ein Ort, an dem an die Geschichten verschiedener Einwanderer erinnert werden soll, von Juden, aber auch von türkischen Gastarbeitern. Solche Museen sind in Ländern wie den USA längst Wirklichkeit. „In Europa“, meint Guggenheimer, „wird es auch langsam Zeit.“
„Manche Geschichten wiederholen sich“, sagt Hanno Loewy mit Blick auf das Hohenemser muslimische Gebetshaus. Die dortige muslimische Gemeinde – großteils Zuwanderer aus der Türkei – verfügt über einen kleinen Gebetsraum mit einem Minarett aus Pappe. Die Baugenehmigung für ein richtiges Minarett fehlt noch. Für die Muslime von Hohenems heißt es daher weiterhin: Beten im Hinterhaus.
Loewy sieht hier einige Parallelen zur jüdischen Gemeinde in Hohenems. Diese musste etwa 150 Jahre warten, bis sie eine Synagoge bauen durfte. Davor wurden auch private Gebetsräume benutzt. „In absehbarer Zeit wird es auch hier eine Moschee geben“, zeigt sich Loewy zuversichtlich.
Keine Kopftücher mehr
Alles eine Frage der Zeit – wie so vieles. Denn auch die muslimische Gemeinde hat sich verändert. „Ich habe diese Leute nach Jahrzehnten ganz anders erlebt“, sagt Guggenheimer, der sich 30 Jahre nach seinem ersten Besuch wieder nach Hohenems aufmachte, „Sie traten viel selbstbewusster auf. Viele Frauen hatten kein Kopftuch mehr.“ Der Schweizer saß erneut mit denselben Familien von damals an einem Tisch. „Wir verstanden uns prächtig. Die jungen sprachen alemannisch und ich schweizerdeutsch.“
Juden und Türken haben auch gemeinsam, dass sie beide mit Vorurteilen in eine Randexistenz gedrängt wurden. „Antisemitismus und Rassismus jedweder Art gehen Hand in Hand“, sagt die Kuratorin des Jüdischen Museums Wien, Felicitas Heimann-Jelinek. Seit den Anschlägen vom 11. September 2001 in New York habe sich das Feindbild vermehrt auf den Islam verlagert. Egal, um welche Art von Diskriminierung es sich handelt, Jüdische Museen seien geeignete Orte, um Rassismus zu bekämpfen, meint Heimann-Jelinek.
Pauschale Vorverurteilungen
„Die Hälfte des Publikums sind Schulklassen, die keineswegs homogen sind. Auch deren verschiedene Hintergründe müssen wir ansprechen.“ So dreht sich die aktuelle Wiener Ausstellung „typisch“ um Stereotypisierungen. Nicht nur die „typisch jüdische Nase“ wird dargestellt, sondern auch pauschale Vorverurteilungen von Farbigen, Asiaten und Muslimen. „Klischees und Stereotype brauchen wir, um uns orientieren zu können“, so Heimann-Jelinek, „doch müssen wir aufpassen, dass Stereotype nicht in Bösartigkeit oder gar Brutalität umschlagen.“ (DUYGU ÖZKAN)
„Die Presse“, Print-Ausgabe, 15.04.2009