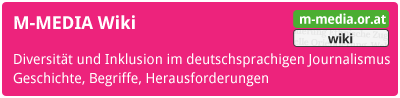Integration als Nagelprobe sozial nachhaltiger Urbanität

- Beitrag erschienen in der März Ausgabe der Zeitschrift RAUM
- Medieninhaber: Österreichisches Institut für Raumplanung - OIR
- Mit freundlicher Genehmigung des Autoren und der Chefredaktion
- http://www.raum-on.at
- Hanesch, Walter (Hrsg., 2011): Die Zukunft der „Sozialen Stadt“ – Strategien gegen soziale Spaltung und Armut in Kommunen, Wiesbaden
- Häußermann, Hartmut, Siebel, Walter (2001): Integration und Segregation – Überlegungen zu einer alten Debatte. In: Deutsche Zeitschrift für Kommunalwissenschaften (DfK), Heft 1, 2001, Im Brennpunkt: Integration und Stadt, Berlin
- Siebel, Walter (2009): Die Zukunft der Städte. (Text zum Vortrag auf dem Mietgerichtstag), Dortmund
- Unterlage zur Pressekonferenz: „Lebensstadt Linz: Soziale Sicherheit und Gerechtigkeit“, 10.11.2011, Linz
- Mag. Tobias Panwinkler ist Mitarbeit des Österreichischen Instituts für Raumplanung - OIR
30.03.2012 | 12:49 | Tobias Panwinkler
Die Immigration von Menschen unterschiedlichster Kulturen macht aus der Stadt einen Ort des Zusammenlebens von Fremden, geprägt von räumlicher Nähe und gleichzeitiger sozialer Distanz. Deshalb braucht gerade die Stadt ein funktionierendes, institutionelles Sozialsystem, das aber durch ökonomischen Strukturwandel und demographische Entwicklungen zunehmend unter Druck gerät. Soziale Kohäsion auch in Zukunft zu sichern, wird zur Kernfrage städtischer Politik.
Seit den 1970er Jahren, in denen der wirtschaftliche Aufschwung seinen Höhepunkt erreichte, entwickelten sich mehrere Trends, die die Gesellschaft grundlegend veränderten. Zu allererst setzte der Strukturwandel ein, die Gesellschaft entwickelte sich zu einer Dienstleistungsgesellschaft und Wissen wurde zu der zentralen Ressource. Niedrigqualifizierte Arbeitsplätze wurden rationalisiert oder ausgelagert. Dies führte dazu, dass europäische Dienstleistungsgesellschaften polarisierter wurden als es die Industriegesellschaften der Nachkriegszeit waren. Immer mehr Menschen erfuhren einen sozialen Abstieg und wurden gesellschaftlich wie räumlich ausgegrenzt.
Zweitens sank die Fertilität, die Zahl der Geburten in Österreich hat sich in den vergangenen 50 Jahren beinahe halbiert. Gleichzeitig werden die Menschen immer älter. Dieser demographische Wandel bewirkt, dass die österreichische Bevölkerung schrumpft und älter wird (ohne Berücksichtigung der Migrationsbewegungen).
Für die Stadtpolitik ergaben sich daraus mehrere Herausforderungen. Immer mehr Menschen leben immer länger in Pension und beanspruchen dabei immer hochwertigere medizinische Versorgung und Pflege. Auch die Nachfrage nach Wohnformen verändert sich.
Auch bezüglich der Migration hat sich ein Wandel vollzogen. Waren es zunächst ab den 1960er Jahren vermehrt „Gastarbeiter/‑innen“ die mit der Absicht nach Österreich kamen, nach wenigen Jahren der „Gastarbeit“ mit dem Ersparten in die Heimat zurückzukehren, blieben bald immer mehr Migrant/‑innen dauerhaft in Österreich. Mit dem Nachzug der Familienangehörigen stieg die Anzahl der Migrant/‑innen weiterhin, trotz Auslaufens der Anwerbeabkommen. Spätestens seit dem EU-Beitritt der östlichen Nachbarländer und dem Wegfall der Grenzen sowie der fortschreitenden Globalisierung ist Österreich zum Einwanderungsland geworden.
Diese drei Trends wurden in den vergangenen Jahren bereits ausführlich beschrieben, es kann erwartet werden, dass sie sich noch stärker ausprägen. Gemeinsam haben sie vor allem eines: Das (großteils in den 1970ern) geschaffene Sozialsystem ist auf die teils drastischen Veränderungen nicht mehr ausgerichtet. Es ergeben sich daher neue Aufgaben, um weiterhin die soziale Kohäsion der (städtischen) Gesellschaft zu gewährleisten.
Staatliche Aufgaben
Um auf die Veränderung der Bevölkerungsentwicklung zu reagieren, wird es mindestens mittelfristig notwendig sein, sowohl das Pensions- als auch das Pflegesystem umzustrukturieren. Denn künftig werden immer weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter sein und in Kassen einzahlen, dafür werden mehr Menschen länger Leistungen beziehen. Um das derzeitige Modell des Pensionssystems langfristig zu sichern, wären mehr Staatseinnahmen aus höheren Beiträgen und gleichzeitig geringere Entnahmen nötig. Gleiches gilt für das Pflege- und Gesundheitssystem, auch hier werden mehr Staatseinnahmen und mehr Beiträge notwendig und müssen gleichzeitig Ansprüche gesenkt werden.
Mit dem Strukturwandel und der Globalisierung einerseits und der Migration andererseits haben sich die Ansprüche an die (Aus-)Bildung geändert, das Bildungssystem muss darauf reagieren. Eine Erhöhung der Chancengleichheit durch Bildung, Förderung des einzelnen Schülers und die Reduktion der Zahl der Schulabbrecher ist notwendig. Diese Maßnahmen können allerdings nicht von der Stadt als einer einzelnen Gemeinde bewältigt werden, sie müssen auf gesamtstaatlicher Ebene umgesetzt werden. Die Stadt kann dabei jedoch eine Vorreiterrolle übernehmen: Sie kann neue Konzepte als Pilotprojekte umsetzen, etwa neue Formen betreuten Wohnens oder Forcierung neuer Schulformen.
Städtische Aufgaben
Die Integration von Menschen in die Gesellschaft, sowohl von Menschen in sozialen Randgruppen, älteren Menschen als auch von Menschen mit Migrationshintergrund ist eine der Hauptaufgaben, die sich durch die oben beschriebenen Trends ergeben. Diese bewirken eine soziale Ungleichheit, die zu einer sozialen Spaltung führen kann.Diese Ungleichheit wird räumlich in eine sozialräumliche Stadtstruktur der „Verinselung“, also der Konzentration verschiedener Gruppen auf spezielle Viertel übertragen, führt also zu Segregation. Die Stadtplanung kann deren Ursachen nicht beheben, dafür benötigt es etwa Investitionen in die Bildung sowie in den Arbeitsmarkt. Allerdings kann sie dafür sorgen, alle Menschen mit ausreichendem Wohnraum zu menschenwürdigen Bedingungen und mit zuverlässiger, moderner Infrastruktur zu versorgen und so sozialpolitische Maßnahmen zu unterstützen. Dafür wird es notwendig sein, den sozialen Wohnbau in allen Vierteln der Stadt zu garantieren und auszubauen. Auch unter Beachtung des demographischen Wandels: In Zukunft wird vermehrt Wohnraum für ältere Menschen benötigt, der barrierefrei und mit den entsprechenden sozialen Dienstleistungen verknüpft ist.
Darüber hinaus sind Ansprechpartner/‑innen notwendig, Menschen, die den Bewohner/‑innen direkt vor Ort bei Problemen helfen und bei Konflikten moderieren. Der Beruf des Hausmeisters ist daher gefragter denn je.
Für Menschen mit Migrationshintergrund gilt dies im Besonderen. Ihr Start in der neuen Heimat erfolgt mit relativ wenigen Ressourcen. Sie ziehen in billige Wohnungen in sozial segregierten Vierteln und daher in unmittelbare Nachbarschaft zu jenen „Einheimischen“, die ohnehin mit großen sozioökonomischen Problemen kämpfen, unter anderem unter einer immer größeren Nachfrage nach immer weniger vorhandenen niedrigqualifizierten Arbeitsplätzen. Den Zuwanderer/‑innen wiederum bleibt oft nichts anderes übrig, als sich um genau jene Jobs zu bewerben, etwa weil ihre in der Heimat erworbenen Diplome nicht anerkannt werden oder weil sie mit der Hoffnung auf eine bessere Ausbildung emigrierten. Für die angestammte Bevölkerung erscheint es, als würden ihnen die Migrant/‑innen die Jobs wegnehmen, für die Migrant/‑innen scheint es, als würden sie nur die niedrigqualifizierte Arbeit verrichten dürfen. Die Zuwanderer/‑innen werden also für ihren Start in die neue Gesellschaft in jene Viertel gelenkt, in denen die Bewohner/‑innen mit sozialem Abstieg konfrontiert sind. Und genau diesen Menschen wird nun auch noch die Aufgabe übertragen, die Zuwanderer/‑innen vor Ort in die Stadt zu integrieren. Wer allerdings gegen den sozialen Abstieg kämpft und dabei in einer existenziell ungesicherten Situation lebt, ist am wenigsten in der Lage, diese Aufgabe zu übernehmen. Im Gegenteil, wegen der großen Konkurrenz und des Gefühls der Hilflosigkeit benötigt es Sündenböcke für die eigene Misere und dafür eignen sich Gruppen, die scheinbar leicht definiert werden können, etwa „Fremde“. Ein großer Fehler wäre es aber, diese soziale Segregation mit ethnischer zu verwechseln. Schließlich sind es soziale Probleme, durch die das Viertel segregiert wird und die den Zuwanderer/‑innen quasi übergeben werden. Hier wird es umso notwendiger sein, Maßnahmen zum Abbau sozialer Segregation umzusetzen.
Eine Segregation der neu Zugewanderten in einem „Einwandererviertel“ kann allerdings auch von Vorteil sein, wenn sie freiwillig geschieht. Das Viertel bietet ihnen ein soziales Netz, in dem wichtige Informationen über Jobs und Wohnmöglichkeiten, Verwaltungsangelegenheiten und Sitten und Gebräuche in der neuen Heimat erworben werden. Viel wichtiger bietet es soziale Kontakte zur eigenen Ethnie, wodurch der „Schock“ der Migration gemildert wird. Das ethnische Viertel bildet quasi einen Brückenkopf, in dem der/die Zuwanderer/‑in Fuß fassen kann, um anschließend in die gesamtstädtische Gesellschaft einzutauchen. Dafür muss allerdings garantiert werden, dass dem Migranten/der Migrantin der Wegzug aus dem ethnischen Viertel möglich ist, etwa durch Antidiskriminierungsmaßnahmen und durch leistbaren Wohnraum in allen Vierteln der Stadt. Der Stadtpolitik kommt hier die Aufgabe zu, zu verhindern, dass das ethnische Viertel zur Falle wird und zu Diskriminierung, Arbeitslosigkeit und politischer Rechtlosigkeit führt. Gleichzeitig kommt ihr die Aufgabe zu, die Integration der Migrant/‑innen in Bildungssystem, Wirtschaft, Politik zu fördern, und ethnische Viertel bieten den Start für diese Integration. Segregation soll daher zugelassen werden, solange sie freiwillig ist, und verhindert werden, wenn sie erzwungen ist.
Aussichten
Die sozialen Ungleichheiten der Stadt haben sich in den vergangenen Jahrzehnten grundlegend geändert und stellen so Stadtpolitik und speziell Stadtplanung vor neue Aufgaben. Aus einer klassischen Hierarchie von reich bis arm wurde ein (sozialer) Raum, der Menschen integriert, aber auch ausschließt. Eine Sozialpolitik der reinen Umverteilung (sozialer Wohnbau, Infrastruktur etc.) reicht daher nicht mehr aus. Menschen, die in Konflikte geraten, benötigen Unterstützung durch Menschen, die diese Konflikte professionell moderieren können, und sie benötigen soziale Netze, die sie auffangen. Die Stadtplanung kann dies unterstützen, in dem sie den Menschen sprichwörtlich den Raum gibt, um solche Netze aufzubauen, damit Ausgeschlossene die Chance zur Integration in die Gesellschaft haben. Gleichzeitig muss es möglich sein, ein Viertel wieder zu verlassen, leistbarer Wohnraum in allen Stadtteilen ist eine Grundvoraussetzung dafür.