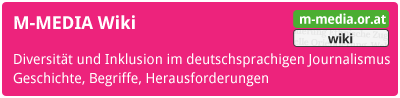Medizin: Migranten werden anders krank

- Die transkulturelle Medizin lässt sich auf zwei Einrichtungen, die sich mit den psychischen Störungen von Migranten befassen, begrenzen: die Abteilung für Sozialpsychologie, Ethnopsychoanalyse und Psychotraumatologie an der Uni Klagenfurt und die Abteilung für transkulturelle Psychiatrie und migrationsbedingte psychische Störungen im AKH Wien.
03.12.2008 | 12:19 | Yordanka Hristozova-Weiss
Ärzte brauchen für Patienten mit Migrations-Hintergrund besondere Kompetenzen – oder Hilfe. Die richtige Auswahl der Übersetzer ist eine entscheidende Voraussetzung für eine gelungene Therapie.
WIEN. Den Patienten mit Schmerzen wegzuschicken und ihn zu bitten, einen Dolmetscher zu holen, gehört zum Alltag zahlreicher Ordinationen und Spitäler. Auf einem solchen Dolmetscher lastet dann nicht nur die Aufgabe, die Sprache, sondern auch die Kultur zu vermitteln. Optimal wäre es natürlich, sich in der Muttersprache behandeln zu lassen. Aber wo findet man etwa einen tschetschenischen Gynäkologen in Wien?
Die richtige Auswahl der Übersetzer ist eine entscheidende Voraussetzung für eine gelungene Therapie: Die Erkrankungsbilder unterschiedlicher Kulturen fallen weit auseinander. Um den Bedarf nach differenziertem Umgang mit Patienten zu decken, erstellte das Wiener AKH daher eine Liste der fremdsprachenkundigen Mitarbeiter. „101 Personen decken insgesamt 31 Sprachen ab“, so Reinhard Krepler, Ärztlicher Direktor des AKH. An Bereichen mit besonders hohem Dolmetschbedarf, wie der Universitätsklinik für Frauenheilkunde, stehen zusätzliche Mitarbeiter zur Verfügung. Wenn erforderlich, zieht das AKH auch externe Dolmetscher hinzu – auf eigene Kosten.
Und abseits der Spitäler? „Ich arbeite in einer dermatologischen Ordination im 20.Bezirk“, erzählt Ella W. „Mehr als 50 Prozent unserer Patienten sind Migranten.“ Oft müssen Patienten gebeten werden, mit einem Dolmetscher noch einmal zu kommen. Meist sind die Begleitpersonen der Nachbar, die Tochter oder der Ehemann. Eine solche Begleitung kann auch problematisch sein: „Junge muslimische Frauen werden oft von den Ehemännern begleitet“, meint Ella W., „meist aus Eifersucht.“
Erst zum Hodscha, dann zum Arzt
Ein weiteres Problem: Türkische Patienten gehen oft nicht zum Arzt, sondern zu ihrem Hodscha (Lehrer). Seine Therapie: Amulette und Koranverse. „Erst wenn das keine Wirkung zeigt, wird ein Arzt aufgesucht“, so Psychotherapeutin Uta Wedam. Sie arbeitet bei Zebra, einem Zentrum für sozialmedizinische und kulturelle Betreuung von Ausländern in Graz. Dort werden Dolmetscher für Russisch, Farsi, Türkisch und andere Sprachen engagiert.
Geholfen wird dort zum Beispiel bei Depressionen – Symptome dafür sind Schlafstörungen und Antriebslosigkeit. Je nach Herkunftsland kommen andere Symptome dazu, etwa Selbstvorwürfe und Schuldgefühle. Generell weisen Einwanderer häufiger psychische Erkrankungen auf als Einheimische. Dies ist oft auf die Migration selbst zurückzuführen.
Kinder von Migranten erkranken dreimal häufiger an Schizophrenie als die eigentliche Zuwanderergeneration, sagt Thomas Stompe von der psychiatrischen Universitätsklinik am AKH. Die Jugendlichen weisen oft eine enorme Identitätsunsicherheit auf, wenn sie Elemente der Gastlandkultur annehmen und Traditionen des Ursprungslandes infrage stellen. Beschwerden wie Kopfschmerzen, Magenprobleme oder wandernde Schmerzen haben ebenfalls oft einen psychischen Hintergrund: In manchen Ländern ist es akzeptiert, Schmerzen zu haben, nicht jedoch psychische Probleme.
Bei der „afrikanischen“ Manifestation der Depression gibt es einen anderen Hintergrund. Die Erkrankung eines Kindes wird etwa auf die Verzauberung durch die in Afrika lebende ungeliebte Großmutter zurückgeführt. Als Gegenmaßnahme werden Rituale eingesetzt, um die Verzauberung aufzuheben. Ein exorzistischer Genesungsvorschlag, der hierzulande wenig akzeptabel klingt.
Die Herausforderung für Mediziner besteht nun darin, kulturbedingte Zeichen korrekt zu entschlüsseln. Damit gewinnt die soziale und interkulturelle Kompetenz der Ärzte an Bedeutung. Ein wichtiger Schritt dazu wäre, transkulturelle Medizin in die universitäre Ausbildung einfließen zu lassen.
(YORDANKA HRISTOZOVA-WEISS, Die Presse“, Print-Ausgabe,03.12.2008)