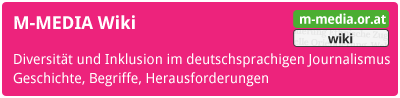Scheinehe: Heiraten für die Aufenthaltsbewilligung

26.08.2009 | 19:11 | Ania Haar
Dass Menschen nicht nur aus Liebe heiraten, sondern auch aus anderen Interessen, ist kein Geheimnis. Wie viele Ehen geschlossen werden, um in Österreich bleiben zu dürfen, ist aber nicht so klar.
Manche nennen es Scheinehe. Maria würde es anders ausdrücken: Nicht aus Liebe, sondern um zu helfen, hat sie geheiratet. Maria (Name von der Redaktion geändert) ist österreichische Staatsbürgerin. Ihr Mann stammt aus Indien. Vor ihrer Heirat kannten sie einander nur als Mitbewohner.
Maria wusste, dass sie sich mit dieser Eheschließung strafbar machen würde. Und sie wusste, dass es ein großes Risiko ist, als Ehepaar zusammenzuleben, obwohl man keines ist. Und doch willigte sie ein.
Ihr Mann erhielt durch die Heirat einen Aufenthaltstitel und den sofortigen Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt. Zumindest galt das damals, zum Zeitpunkt ihrer Heirat, noch. Mit dem Jahr 2006 kam eine restriktivere Gesetzgebung – das neue Fremdengesetz; Scheinehen mit Drittstaatsangehörigen sollten dadurch unattraktiv werden.
„100 oder 300 Fälle“
Doch wie viele Scheinehen gibt es tatsächlich? Über ihre Anzahl gibt es nur Vermutungen. Gerald Tatzgern vom Bundeskriminalamt geht von einer „dreistelligen Zahl“ aus. Ungefähr, denn „ob es 100 oder 300 sind, kann ich nicht sagen“.
Im Jahr 2008 wurden laut Statistik Austria 27.075 Ehen zwischen Österreichern geschlossen. Und es gab 6353 Fälle, in denen ein Partner nicht Österreicher war. Gesondert ausgewiesen in der Statistik sind dabei Eheschließungen zwischen Österreichern und 2238 Personen aus dem ehemaligen Jugoslawien sowie 856 Personen aus der Türkei. Allesamt Scheinehen? Nein, aber die beiden Nationalitäten bilden jene Gruppe, in der die Polizei Scheinehen am häufigsten vermutet.
Doch wer heiratet eigentlich wen? Zumeist sind es Österreicherinnen aus „niedrigem sozialem Niveau“, erklärt Tatzgern, „die einen Nichtösterreicher heiraten“. Den Frauen würden dafür in aller Regel zwischen 3000 und 5000 Euro angeboten. Wird das versprochene Geld nicht gezahlt oder das Zusammenleben für beide Partner unerträglich, so fühlten sich die Österreicherinnen häufig betrogen und zeigten sich selbst an. Denn nur bei der Selbstanzeige ist nicht mit Strafe zu rechnen.
Im vergangenen Jahr wurden in Österreich 180 Scheinehen nachgewiesen. 2009 zählte die Polizei bis Ende Juli 82 Fälle. Die Aufklärungsquote bei diesen Fällen ist – wenig verwunderlich – sehr hoch: 99,4 Prozent. Denn: Der „Täter“ ist bekannt. Von den Fällen gehen jedoch nur wenige an die Staatsanwaltschaft. Wie viele davon tatsächlich vor Gericht verhandelt werden, ist nicht bekannt.
Konstruiertes Problem?
Kritik an der Arbeit der Polizei übt Angela Magenheimer von „Ehe ohne Grenzen“, einem Verein, der sich für die Rechte von binationalen Paaren einsetzt. „Es gibt keine Statistiken über Scheinehen (vor Gericht, Anm.). Gäbe es sie, würde man nämlich sehen, dass der ganze Behördenaufwand nichts wert ist“, sagt Magenheimer. Dass es Scheinehen gibt, streitet sie nicht ab. Allerdings liege ihre Zahl weit unter den Vermutungen. Ähnliches sagt die Politologin Irene Messinger, die Daten der Wiener Fremdenpolizei ausgewertet hat: 2005 ermittelte die Polizei in 1999 Fällen mit Verdacht auf Scheinehe. In 168 Fällen konnte dies nachgewiesen werden. Messinger: „Aufgrund der Erfolgsquote von rund acht Prozent stellt sich die Frage, ob die Behörden in ihren Ermittlungen nicht so erfolgreich sind, wie sie vorgeben oder das Problem der Scheinehen nur konstruiert ist.“
Dennoch gab es laut Statistiken des Innenministeriums heuer im ersten Halbjahr 77, im gesamten Jahr 2008 ganze 231 Aufenthaltsverbote wegen Scheinehen. Dem Aufenthaltsverbot folgt in der Regel die Ausweisung.
Binationale Paare – sind sie für die Polizei allgemein verdächtig? Tatzgern verneint. „Der Verdacht“, sagt er, „muss begründet sein.“ Und er ist es etwa dann, wenn beim Standesamt ein Paar erscheint, das nur mittels Dolmetscher miteinander kommuniziert, oder wenn der Eindruck entsteht, dass die beiden sich dort zum ersten Mal sehen.
Die Sache mit dem begründeten Verdacht sehen die Betroffenen – binationale Paare – oft anders. Tatsächlich wird nach der Eheschließung penibel geprüft. Die Fremdenpolizei befragt etwa Arbeitskollegen und Nachbarn.
Dazu kommen intime Fragen an das Ehepaar: Welche Farbe hatte die Bettwäsche beim ersten Geschlechtsverkehr? Wer ist zuerst ins Bett gegangen? Oder: Worüber haben sich die beiden beim ersten Treffen unterhalten? Kann das binationale Paar diese und ähnliche Fragen nicht beantworten, macht es sich verdächtig.
Fragen über sexuelles Leben
Es sei „ein sehr sensibler Bereich“, gesteht Tatzgern ein, „denn wir müssen in die intimsten Bereiche des Lebens eindringen und etwa auch Fragen über das sexuelle Leben stellen“. In den Ermittlungen gibt es oft nur eine Reihe von Indizien; Beweise sind selten.
Dass die Grenzen zwischen Ehe, Zweckehe und Scheinehe mitunter fließend sind, weiß auch der Polizeibeamte. Etwa, wenn Österreicher EU-Staatsbürger heiraten, um Erb- oder Steuervorteile auszukosten. Überprüft wird das freilich nicht.
Maria ist mit ihrer Heirat ein großes Risiko eingegangen. Warum eigentlich? „Mein Mann hätte sonst weniger Chancen gehabt, in Österreich zu bleiben.“ Der Umstand, dass die beiden ohnehin zusammen wohnten, gemeinsame Finanzen hatten und sich relativ gut kannten, trug zu ihrer Entscheidung bei.
Maria möchte nicht von Scheinehe sprechen. In ihren Augen war es eine Zweckehe, damit ihr Mitbewohner eine Aufenthaltsbewilligung bekommen konnte. Eine intime Beziehung war die Ehe von Maria und ihrem indischen Mann nie.
Sie beide hätten gut zusammengelebt, erinnert sie sich. Trotzdem ist Maria heute geschieden. „So war es verabredet.“
■Wie viele Scheinehen es in Österreich gibt, ist nicht bekannt. Gerald Tatzgern (Bundeskriminalamt) geht von einer dreistelligen Zahl aus. Im Jahr 2008 wies die Polizei in 180 Fällen Scheinehen nach.
Meist sind es Österreicherinnen, die eine derartige Verbindung eingehen. Ihnen wird in aller Regel eine Bezahlung zwischen 3000 und 5000 Euro angeboten.
(ANIA HAAR, „Die Presse“, Print-Ausgabe, 26.08.2009)