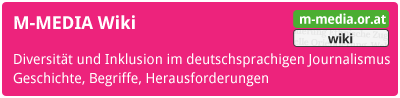Vorreiterin: Kärntens afro-österreichische Opernsängerin

- Bibiana Nwobilo wurde in Nigeria geboren und kam mit sechs Jahren nach Kärnten. In Klagenfurt und Wien studierte sie Gesang und schloss ihr Studium im Jahre 2006 ab. Im Jahre 2007 in Baden bei Wien gewann sie den ersten Preis des Internationalen „Heinrich Strecker Gesangwettbewerbes“. Ein Jahr danach erhielt sie in der Schweiz den Preis der renommierten „Professor Armin Weltner Stiftung“. Und im Jahre 2012 kam die Anerkennung des Landes Kärnten mit dem Förderungspreis des Landes Kärnten für Musik.
29.07.2013 | 11:05 | simon INOU
INTERVIEW. Bibiana Nwobilo spielte bei der Grazer Styriarte 2013 die Rolle von Dido in „Dido und Aeneas“ einer Oper in drei Akten von Henry Purcell. Ende Juni war sie drei Tage lang im Wiener Konzerthaus Gesangssolistin in Carl Orffs berühmter Carmina Burana. Im Jänner 2014 wird sie auf Skandinavien-Tournee sein. Nwobilo wurde in Oweri (Nigeria) geboren und kam mit sechs Jahren nach Kärnten. Die mehrfach gekrönte Opernsängerin sprach mit M-MEDIA über ihre Liebe zur Soulmusik, multiple Identitäten und warum sie in der Oper nicht immer den Originaltext singt. simon INOU stellte die Fragen.
M-MEDIA: Sie sind mit sechs Jahren von Nigeria nach Kärnten gekommen. Wie war das für Sie?
Nwobilo: Es war nicht leicht. Ich hatte das Glück, dass ich im Dorf wo ich aufgewachsen bin, eine halb-ägyptische Freundin hatte. Dadurch habe ich mich nicht alleine gefühlt. Es waren nicht nur schwierige sondern auch schöne Zeiten. Ich habe als Kind schon gelernt, dass man sich im Leben durchboxen muss.
Gerade ist David Alaba als Vorbild in aller Munde. Wer war Ihres als Sie Kind waren?
Michael Jackson, (lacht) Whitney Houston. Marvin Gaye, Alicia Keys. Ich war mehr in der Soul Branche zu Hause, ich bin damit aufgewachsen. Ich mag gern Lieder mit Emotionen, die man wirklich im Körper spüren kann. Die Soul Music kann das sehr gut mit ihren vielen Farben und Facetten. Nun fühle ich diese Emotionen auch mit klassischer Musik. Zur Oper bin ich sehr spät in meinem Leben gestoßen. Aber es fiel mir immer leichter mit klassischer Stimme zu singen als soulig.
Als Opernsängerin spielt in Ihrem Beruf afrikanische Musik wohl keine große Rolle?
Nein, aber daran hätte ich großes Interesse, wenn ich einen Coach hätte. Außerdem glaube ich, dass die „afrikanische Musik“ sehr breit gefächert ist. Ich wüsste gar nicht wo ich anfangen soll.
In der Opernwelt, verkörpern Sie als Sängerin verschiedene Identitäten. Wie definieren Sie sich im realen Leben?
Kosmopolitisch. Meine österreichischen Wurzeln kann ich nicht verleugnen. Meine afrikanischen auch nicht. Ich bin eine Afro-Österreicherin. Ich bin Kärntnerin. Ich bin zufrieden. Ich arbeite mit kreativen Menschen in guten Produktionen, die mir Spaß machen. Und privat geht´s mir auch gut. Was will man mehr im Leben?
Wie lebst du diese multiplen Identitäten in deiner Berufswelt?
Im Bereich der afrikanischen Musik wird immer erwartet, dass der Afrikaner tanzt, Trommel spielt und immer wild ist. Ich spiele keine Trommel und tanze manchmal in der Küche wild, und manchmal bin ich recht temperamentvoll. Trotzdem passe ich nicht in das weit verbreitete Bild der „AfrikanerIn“. Als ich angefangen habe Auftritte zu haben, bekam ich viele Ratschläge: Du solltest deine Haare so machen, sie sind zu wild, du solltest vielleicht deinen Nachnamen – Nwobilo – ändern weil er zu exotisch ist. Also wollten sie mich an die Szene angleichen. Ich habe das eine Zeit lang gemacht und später bemerkt, dass ich mich nicht wohl dabei fühlte und aufgehört dieses Theater beidseitig mitzumachen.
Warum?
Weil es immer für irgend jemanden etwas gibt was nicht passt. Man kann es nie allen Recht machen und ich habe mir gesagt, entweder sie nehmen mich so wie ich jetzt bin oder sie sollen es sein lassen. Ich fühle mich jetzt viel authentischer.
Das ist sicher ermutigend für viele junge Menschen, die noch auf der Suche nach sich selbst sind.
Je extrovertierter und extravaganter man ist – natürlich auf positive Weise – desto mehr Chancen hat man von der Gesellschaft akzeptiert zu werden. Niemand mag Miesepeter und Schwarzmalerei! Es ist auch nicht schlecht etwas zu können was andere nicht können. Das ist ein Mehrwert. Schwarze sollten nicht nur gut, sondern drei bis vier Mal so gut sein. Man muss sich, wie die Meisten, beweisen und immer versuchen, besser als alle anderen zu sein! Wenn jemand ein Vorurteil gegen schwarze klassische OpernsängerInnen hat, muss man sie mit Können vom Gegenteil überzeugen. Man darf Kritik nie zu persönlich nehmen.
Sie arbeiten in einer Welt, in der es kaum Schwarze Menschen gibt. Was sind Ihre Besonderheiten?
Als Sopran ist meine Stimmfarbe ganz anders. Ich habe eine recht dunkle Stimmfarbe auch in der Höhe. Viele denken sich: Ah, das passt nicht zu der Rolle, das klingt dramatisch. Viele glauben, dass ich transponiere, das heißt, dass die Noten tiefer gesungen werden als das Original.
Warum haben viele diesen Eindruck
Weil sie die Klangfarbe nicht zuordnen können und weil viele Rollen, für die ich prädestiniert bin, mit hellen Stimmen besetzt werden.
Wäre das Netrebko auch passiert?
Nein ich glaube nicht. Netrebko hat zum Beispiel die Traviata gesungen obwohl sie, meiner Meinung nach, nicht der typische Koloratursopran mit ihrer warmen, vollen Klangfarbe, für diese Rolle ist. Sie singt quer durch den Gemüsegarten – und das macht sie ausgezeichnet und es wird auch akzeptiert.
Warum nicht bei Ihnen?
Weil ich nicht berühmt bin (lacht). Wenn man berühmt ist, kann man sich aussuchen, welche Rollen man darstellen möchte.
Ist die Opernwelt wie die Modewelt noch sehr westlich weiß europäisch in Besetzung und Repertoire?
Eigentlich schon. Es muss ein Umdenken in den Köpfen der Leute stattfinden. Es gibt sehr wenige Schwarze in dieser Opernwelt. In den USA kenne ich ein paar Kollegen, die nur Porgy&Bess spielen. Ich finde man sollte wirklich qualitativ die Rollen Besetzen – für die äußere Verwandlung ist dann sowieso die Maske zuständig.
Warum nur Porgy&Bess?
Weil Gershwin vorgeschrieben hat, dass Porgy&Bess nur von Schwarzen gespielt werden darf. Da hat er viele Jobs gesichert. (lacht)
Was sagen Sie zu dem „Blackface-Phänomen“? Das kommt in Europa noch immer vor.
Bei „Blackface“ malen sich weiße Künstler das Gesicht schwarz und spielen den „naiven, trunkenen, schwachsinnigen und immer fröhlichen Schwarzen “, so wie Weiße sich Schwarze früher vorstellten. Das finde ich traurig. Es gibt auch bei der Zauberflöte so eine Rolle. Der Monostatos ist auch ein Schwarzer und wird immer von einem Weißen gespielt. Im Text steht: Alles fühlt der Liebe Freuden, Schnäbelt, tändelt, herzt und küsst; Und ich sollt‘ die Liebe meiden, weil ein Schwarzer hässlich ist!
Wie ist es für Sie wenn Sie so etwas hören und mitspielen?
Ich fühle mich in Jahrhunderten zurückversetzt, weil es eine Diskriminierung ist und alle gehen darüber hinweg. Das war damals zu Mozarts Zeiten akzeptabel. Eigentlich müsste diese Sache gestrichen werden, aber die Zauberflöte wird immer, in dieser Art und Weise gesungen. Ich würde das schon ändern. Es gibt viele Texte in der Opernwelt die der Zeit angepasst werden sollten.
Gibt es andere Beispiele wo Sie die Texte verändern könnten?
Ja z.B. in der Oper Giuditta von Franz Lehar steht: „Meine Lippen, sie küssen so heiß, meine Glieder sind schmiegsam und weiß.“ Wenn ich diese Arie singe, singe ich sie so: „… meine Glieder sind schmiegsam und weich.“ Da kann man schon was machen. Das ist kein Problem.
Wir wünschen Ihnen alles Gute dabei und vielen Dank für das Interview.
Danke auch.
Kommentieren Sie den Artikel
Weitere Artikel von simon INOU
- Wien: Verurteilte Islamhasserin war bei Koranverbrennung in den USA dabei
- Hamburg: Wofür ein Denkmal für Kriegsverbrecher in der Hauptkirche St. Michaelis?
- An Papst Franziskus: Der 1. Genozid des 20. Jahrhunderts fand in Afrika statt
- Schwarze Menschen in Österreich, Jahresbericht 2009
- Samuel Loe: „Der Glaube an die Hexerei legt die Kreativität der Afrikaner lahm.“