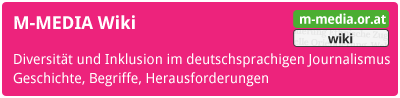Migranten: Bluten für Anerkennung

30.06.2009 | 18:52 | Nasila Berangy
Weshalb auch Profis beim Boxen kein Blut sehen können – und nie außerhalb des Rings kämpfen: Beim Gong ist der Kampf vorbei. Das könne man steuern, so der 26-jährige dreifache Staatsmeister Foad Sadeghi.
WIEN. „Ich kann kein Blut sehen“, erzählt der ehemalige Profiboxer Ilhan Sari. Das ist auch der Grund, warum er den Wunsch seiner Eltern, Medizin zu studieren, ausschlug und lieber Boxer wurde. Wie das denn zusammenpasse? Beim Medizinstudium müsse man sezieren, und das wäre doch etwas anderes, so der Athlet.
Begonnen hat alles, als er 12 Jahre alt war. Da er als Kind sehr schüchtern war, brachte ihn seine Mutter zum Taek Wan Do. Sie wollte, dass er selbstbewusster wird. Ihn hat das aber gar nicht gereizt. Es ging lediglich um Selbstverteidigung. Er habe als Jugendlicher viel negatives Feedback bekommen. Sei es in der Schule oder privat, in der Familie. Die Scheidung seiner Eltern habe er nur schlecht verarbeiten können. Schließlich entdeckte er das Boxen für sich. Das war dann „wie eine Therapie“, so der 25-Jährige. Denn da konnte er sich abreagieren.
Es geht auch um den Adrenalinkick: zigtausende Zuschauer und Kamerateams, die auf einen fokussieren. Sari: „Das ist das Interessante dabei. Es geht um den Kick.“ Der Boxkampf habe nicht das Ziel, den Gegner zu vernichten, es sei viel eher wie ein Spiel. Darin besteht für Sari auch der Unterschied zur Straße. Natürlich gebe es aber auch Jugendliche, die sich durch „den Sport beweisen müssen, um eine Stellung in der Gesellschaft zu erlangen“. Sari muss es wissen, denn er war lange Zeit Besitzer eines Kampfsportstudios, bevor er mit einem Kollegen eine Werbeagentur eröffnete.
Für Pit Bull alias Foad Sadeghi gehört Gewalt unbestritten zum Kampfsport dazu. Eine gewisse Aggression im Ring sei notwendig, sonst könne man nicht gewinnen. Aber Profis, so Sadeghi, hegten außerhalb des Ringes keinerlei Aggression. Beim Gong ist der Kampf vorbei.
Das könne man steuern, so der 26-jährige dreifache Staatsmeister. Vor und nach dem Kampf geht man auch schon gemeinsam etwas trinken. Dass sich Vorurteile halten, kann er verstehen, denn es gebe durchaus auch Leute, die nur einen Ausweis anstreben, um auf der Straße zu zeigen, was sie können. Ihn interessiere das aber nicht.
Boxender Schönheitschirurg
Gegen seine Eltern, die das Boxen strikt abgelehnt und ihn lieber als Akademiker gesehen hätten, setzte er sich durch. Dennoch hat er sich für kommendes Wintersemester im Fach Sportmanagement inskribiert. Sein Schüler, Artur Worseg, ein prominenter Schönheitschirurg, wollte ihn nur unter der Bedingung bezahlen, dass er seine Matura nachholt. Er willigte ein und sah, dass er sowohl das Boxen als auch die Schule unter einen Hut bringen kann. Und es sei schließlich besser ein „zweites Standbein zu haben“.
Artur Worseg ist auch für Ilhan Sari das Paradebeispiel, dass sich nicht nur „Migranten aus den Slums“ für das Boxen interessieren, sondern die Klientel breit gefächert ist. Sadeghi sieht das ähnlich: Boxen ist für ihn einfach nur eine Sportart, die in den letzten Jahren populärer geworden ist. Da auch einige Migranten vertreten waren, hat es Jugendliche mit Migrationshintergrund angezogen. Für Michael John, Professor am Institut für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte an der Johannes Kepler Universität Linz, ist der Faktor der Role-Models entscheidend. Denn der Nachahmungseffekt ist groß.
Österreicher quälen sich weniger
Hinzu kommt, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund eine höhere Bereitschaft haben, sich zu quälen, und auch mehr Ausdauer mitbringen – sie sind öfter mit sozialen und ethnischen Vorurteilen konfrontiert. Aber, so John, wenn sie sich als schneller und besser erweisen, dann sind die Vorurteile egal.
Hier führt er den Trainer als Beispiel an: Dieser könne noch so große Vorurteile haben. Ist jemand besser, dann sei dies das Einzige, was zähle. Dabei hat der Boxsport den Vorteil, dass man auf sich selbst gestellt ist. Bei einem Mannschaftssport wie Fußball hingegen sei man von den Mitspielern abhängig.
John: „Faktum ist, junge Österreicher wollen sich weniger quälen, sie sitzen lieber vor dem Computer, während Migranten um Anerkennung buhlen.“ Auch wenn sie dafür bluten müssen. Obwohl sie gar kein Blut sehen können. (NASILA BERANGY)
„Die Presse“, Print-Ausgabe, 01.07.2009