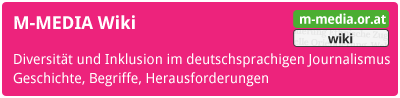MARA MATTUSCHKA: Die totale Reorganisation der Welt
Die Grande Dame des österreichischen Experimentalfilms Mara Mattuschka im Gespräch mit KINOSALON-Kurator Ascan Breuer über die Zusammenhänge zwischen ihren Migrationsgeschichten und ihrem Filmschaffen.
Startseite des KINOSALON-Blogs – KINOSALON auf Facebook – Filmprogramm des KINOSALONS
Dieses Interview ist Teil einer Serie im Rahmen des KINOSALONS „East of Vienna, South of the Sun„. In diesem KINOSALON-Blog erscheinen auch Gespräche mit den anderen beteiligten Filmemacherinnen Nina Kusturica, Kurdwin Ayub und Miriam Bajtala, sowie ein persönliches Statement des Kurators Ascan Breuer.
ASCAN BREUER: Wann und wieso bist du aus Bulgarien weg?
MARA MATTUSCHKA: 1976, als ich 16 Jahre alt war, bin ich mit meinen Eltern nach Österreich gekommen. Meine Mutter war hier Korrespondentin. Sie war eine gute Journalistin! Mein Vater war Geiger und hat hier im Orchester gespielt. Er ist auch hier gestorben, und meine Mutter ist dann zurückgegangen. Aber ich bin hier geblieben.
ASCAN: Da tobte noch der Kalte Krieg und es gab den Eisernen Vorhang. Waren deine Eltern denn Kommunisten, oder warum konntet ihr das Land so einfach verlassen?
MARA: Nein, meine Familie tendierte damals eher zur zweiten Partei, der Bauernpartei. Mein Großvater war vor dem zweiten Weltkrieg Demokrat, ein Intellektueller und Zeitungsverleger. 1942 wurde er aber von den Nazis ohne Urteil erhängt. Und meine Mutter hatte es dann im kommunistischen Bulgarien auch schwer gehabt. Trotzdem hat sie eine Karriere gemacht – also eine neutrale. Die kommunistischen Regime in Deutschland, Russland und Bulgarien waren ja vollkommen unterschiedliche Welten: Russische Diplomaten und Korrespondenten durften ihre Familien und Kinder gar nicht in den Westen mitnehmen. In Bulgarien war das aber erlaubt. Und mein Vater war sogar als Musiker über den sogenannten ‚Technoexport‘ ins Ausland geschickt worden: In Bulgarien gab es einen Überschuss an Musikern, und die sind dann in die ‚Dritte Welt‘ exportiert worden. ‚Technoexport‘ klingt etwas absurd in diesem Zusammenhang. Aber er war deshalb lange als Musiker in Kuba und Kairo. In Bulgarien wäre er sonst arbeitslos gewesen.
ASCAN: Warst du dort auch mit?
MARA: Ja, aber nur auf Besuch. Kuba war für mich ein einschneidendes Erlebnis! Da habe ich eine ganz andere Welt kennen gelernt: die tropikale Welt! Du musst dir vorstellen: Da war ich gerade einmal zwölf! Ich kannte bis dahin ja nur das graue Bulgarien. In Havanna passiert das Leben größtenteils auf der Straße, die Menschen sind viel direkter, und die Farben sind einfach viel stärker. Also mir kam es utopisch schön vor! Danach wollte ich nicht mehr wirklich zur Schule gehen, und habe angefangen zu malen.
ASCAN: …aber stattdessen bist du in Wien gelandet. Warum nicht in der Karibik?
MARA: Der Traum ist immer noch in mir, ich empfinde mich als sehr südländisch.
ASCAN: Bist du dann denn hier weiter zur Schule gegangen?
MARA: Ich habe ja erstmal kaum Deutsch gesprochen. Bevor ich kam, habe ich zwei Wochen lang Deutsch bei einer entfernten Tante gelernt. Sie war eine besondere Person: Sie war lange Nonne in einem Schweizer Kloster. Sie hatte so eine Art Crash-Methode und hat gleich mit ganzen Sätzen angefangen: ‚Ich habe keine Verwandten, ich habe nur eine Tante.‘ Das war mein erster deutscher Satz, und überhaupt die ersten deutschen Wörter! Hier in Wien hat man mich aber in die damalige Englische Schule eingeschrieben, das ist jetzt die Internationale Schule. Die ist jetzt eine Eliteschule, aber damals war das mehr eine Absteige für Ausländer aller Art: Es gab sehr viel Schüler aus dem Libanon und aus Israel, aus Indien und der gesamten Welt, aber keine Luxusstudenten wie heute. Bis zur Universität, und auch in der Universität, waren meine Freunde und Bekannten hauptsächlich Ausländer. Ich kannte keinen einzigen Österreicher in der Zeit! Die ersten Österreicher lernte ich erst näher kennen, als ich auf die Akademie kam (Anm.: Akademie der Bildenden Künste, Wien).
ASCAN: Bevor du also endgültig zur Kunst gefunden hattest, warst du noch auf der Uni? Was hast du denn dort studiert?
MARA: Ethnologie. Als Ethnologin um die Welt zu reisen und auch Filme über dies oder jenes zu machen, das war schon Thema. Ich erinnere mich an diese Feldforschungsfilmchen, die großteils gefakt bis lächerlich waren. Da sieht man zum Beispiel, wie sie mit zwei Holzstücken Feuer machen, am Ende aber das Feuerzeug rausholen; dreschen vortäuschen, indem sie mit Stöcken auf Sand hauen, solche Sachen. Einige waren wirklich sehr, sehr komisch. Aber die Ethnologie an sich ist eigentlich schon passé. Die kann man als Wissenschaftler nur historisch wahrnehmen. Die Welt schaut jetzt anders aus. Jetzt ist kein Platz mehr für eine Ethnologie, wie sie damals in Wien unterrichtet wurde.
ASCAN: Hast du dich auch einmal in dem Metier versucht?
MARA: Ich habe bisher nur einen einzigen dokumentarischen Film gemacht: über neun ältere Frauen, die in Wien ‚Erinnerungstheater‘ machen. Den habe ich aber nicht sehr oft gezeigt, weil ich mich auf diesem Terrain sehr unsicher fühle: Generell habe das Gefühl, dass es beim Dokumentarfilm schwierig ist zu trennen, was Inszenierung und was ‚echt‘ ist.
ASCAN: Deshalb bist du dann auf die Akademie gegangen und hast endlich Malerei studiert?
MARA: Ich wollte schon vor der Uni auf der Akademie studieren: Bühnenbild. Da bin ich aber durchgefallen. Jahre später bin ich dann tatsächlich in der Klasse von Maria Lassnig aufgenommen worden. Sie hatte damals die Trickfilmabteilung installiert. Da habe ich dann angefangen, allerlei Filme zu inszenieren.
ASCAN: …also Animationsfilme?
MARA: Ja, im erweiterten Sinne. Sehr bald habe ich dann festgestellt, dass ich meine Malerei durch den Überfluss der gemalten Filmbilder und die zwangsläufige Reduktion verrate. Die Malerei sollte Malerei bleiben, die konnte man nicht stilisieren zu Einzelbildern, aus denen man dann Filme macht. So dachte und fühlte ich damals. Ich war ja schon immer ein bisschen idealistisch und hochtrabend. Also habe ich eben mehr mit Gegenständen gearbeitet. Aber es ist auch etwas anderes in mir wieder wachgerüttelt worden: nämlich dass ich damals, als ich in Bulgarien mit dem Malen anfing, auch sprachlich sehr vieles wollte und Geschichten geschrieben habe. Vielleicht wäre ich eine Schriftstellerin geworden, wenn ich in Bulgarien geblieben wäre: Geschichten erzählen in Bildern, Prozesse zeigen in Bildern. Oder ich wäre Nonne geworden. In beiden Berufen kann man im Stillen vor sich hinwirken, ohne sich anpassen zu müssen. Als Pubertierende bin ich damals mit meinen Freundinnen öfters durch dir Klöster im Balkangebirge gereist. Das hat mich immer sehr angezogen.
ASCAN: Bist du denn so religiös?
MARA: Nein, so richtig religiös war ich nie. In meiner Familiengeschichte gibt es sogar einen Ahnen im 17. Jahrhundert, der vom Patriarchen von Konstantinopel exkommuniziert wurde, weil er als Priester in der Kirche Gott beschimpft hatte. Er und die ganze Familie bis ins neunte Glied wurden verdammt – und ich bin das neunte Glied! Theoretisch dürften wir gar nicht christlich-orthodox getauft sein. Ich bin zwar getauft, aber irgendwie wurde in der Familie immer davon gesprochen, dass dieser Fluch noch laste. Generell ging es mir aber beim Mönchischen nicht um Religion, sondern ich wußte nicht, wo ich mich in einer kommunistischen Gesellschaft sehen würde: Es war kein Platz für mich da!
ASCAN: Deshalb bist du bis zum heutigen Tag in Österreich geblieben…
MARA: Ja, ich bin anpassungsfähig. Ich habe hier eine Sphäre gefunden und auch Kinder geboren. Hier fühle ich mich mehr oder weniger heimisch. Inzwischen fühle ich mich sogar sehr wohl. Ich habe einfach genug Arbeit, deshalb habe ich nicht viel Zeit darüber nachzudenken, wo es besser wäre, oder anders wäre. Das wäre genauso, wäre ich woanders. Ich bin sehr anpassungsfähig, auch optisch. Mir passiert es immer wieder, dass man mich für einheimisch hält, egal wo ich hinfahre: in Spanien genauso wie in Italien, in den slawischen Ländern sowieso. In Lateinamerika hält man mich für Lateinamerikaner: In Brasilien hat sich eine wildfremde Frau weinend auf mich gestürzt, um mir ihr Leid zu klagen – auf Portugiesisch! Sogar in Japan hat man mich nach kürzester Zeit nicht mehr von den Einheimischen unterscheiden können. Nur in Deutschland bin ich die Österreicherin. Und hier bin Österreich bin ich natürlich weiter die Bulgarin.
ASCAN: Und in Bulgarien?
MARA: Seit meine Mutter gestorben ist, war ich lange nicht mehr da. Die Bulgaren haben mich jetzt zum ersten Mal zu einer Filmschau eingeladen. Die waren überrascht, dass ich Bulgarin bin, obwohl das ja gar kein Geheimnis ist. Ich habe sehr viele Briefe aus Bulgarien bekommen von Leuten aus Bulgarien, die meine Filme gesehen haben und sehr beeindruckt waren, hauptsächlich Leute aus der Branche: experimentelle Filmemacher. Sie wollen mich zu Workshops und Screenings einladen. Aber das ist erst jetzt so, dass etwas aus Bulgarien zurückkommt.
ASCAN: Freut dich das?
Ich hab das immer eher gefürchtet, denn ich kenne ‚die Bulgaren‘: Sie suchen jetzt irgendwelche Leute aus dem Ausland, die sie dann zu Stars erheben und hofieren können. Und das will ich nicht. Ich will mich natürlich auch nicht rar machen, aber ich mag jetzt auch nicht so ein Riesen-Tamtam. Wenn irgendein ein Tamtam gemacht wird, dann eher ohne mich. Es soll die Filme betreffen. Andererseits ist Bulgarien im Moment am verhungern, und man müsste eigentlich ein schlechtes Gewissen haben, dass man nicht in Bulgarien wirkt.
ASCAN: Keine Sehnsucht?
MARA: Nein, nicht wirklich. Ich habe andere Bulgaren in Wien getroffen, die von Nostalgie regelrecht verfolgt werden. Aber das sind hauptsächlich Leute, die aus der Provinz kommen, aus den Dörfern, die in einer Landschaft aufgewachsen sind. Ich bin ja in Sofia groß geworden. Vielleicht hat es aber schon auch mit der Familiengeschichte zu tun, weil meine Familie unter allen Regierungen sehr gelitten hat: Meine Mutter ist 1925 in der Migration geboren in Prag worden. Also hat es schon eine gewisse Familientradition, dass man aus Bulgarien raus will oder muss.
ASCAN: Vielleicht ist das der Fluch des Patriarchen von Konstantinopel: Die ewige Wanderschaft…
MARA: Ja, ja, schon, ein bisschen so was: die Heimatlosigkeit. Das ist aber nicht unbedingt der schlimmste Fluch. Allerdings litt ich tatsächlich lange Zeit bei jedem Grenzkontrollpunkt unter Schweißausbrüchen, nicht nur auf Reisen nach Osten sondern auch nach Westen. Das war etwas, was ich seit meiner Kindheit mit mir herumgetragen haben muss: diese Angst vor Uniformierten und vor Grenzübergängen, obwohl meine Papiere natürlich in Ordnung waren. Diese Angst hat man wahrscheinlich in der kommunistischen Welt implantiert bekommen. Es hat lange Zeit gedauert, bis ich das losgeworden bin. Jetzt ist es nicht mehr da.
ASCAN: Dann musst du eine große Befürworterin der ‚europäischen Idee‘ sein?
MARA: Ja, das bin ich. Es müsste eigentlich die ganze Welt betreffen: also eine totale Reorganisation der Welt, eine Umrekonstruktion von unten bis oben!
ASCAN: Wie schlagen sich diese persönlichen Bezüge in deinen Werken nieder?
MARA: Nicht direkt, aber indirekt natürlich überall. Alles was man macht, auch wenn es die größte Fiktion ist, hat mit einem selbst zu tun. Ich habe das gerade jetzt auch wieder beim Drehbuchschreiben bemerkt, dass jedes Drehbuch so etwas wie Selbstanalyse beinhaltet: Man hinterfragt seinen Ethos. Ich glaube, in all meinen Filmen geht es um Identität und um die Schwierigkeiten der Identität: um gespaltene Persönlichkeit. Bei „SOS Extraterrestria“ geht es zum Beispiel um eine Person, die vollkommen aus einer anderen Welt kommt und nicht anpassungsfähig ist, wie ein Elefant im Porzellanladen. Die vielen Identitäten, die ein Mensch besitzt, sind in jedem Film Thema gewesen – aber nicht so explizit das zentrale Thema, sondern ein emanzipatorisches Thema, das jeden Menschen betrifft, auch jene, die im eigenen Land geblieben sind. Die unterliegen ja den gleichen Kräften: zum Beispiel in der Pubertät, wo man sich mehr oder weniger individualisiert und eine eigenständige Person wird. Da kommt es auch zu solchen Abspaltungen und Kreuzungen, wo man sich in eine Richtung entwickelt, die anders ist, als sie bis dahin angesagt war. Emanzipation ohne Persönlichkeit und Persönlichkeit ohne Wandlung geht gar nicht.
(Transkription: Veronika Karim)
In diesem Blog erscheinen Interviews mit den am KINOSALON „East of Vienna, South of the Sun„ beteiligten Filmemacherinnen:
– NINA KUSTIRICA: Der Welt treu bleiben
– KURDWIN AYUB: Die große Grenzenlosigkeit fühlen
– MIRIAM BAJTALA: Ein volleres Leben
– ASCAN BREUER: Mache ich eigentlich „migrantische“ Filme? (Statement des Kinosalon-Kurators)
Der KINOSALON ist Veranstaltung im Rahmen von WIENWOCHE, in Kooperation mit This Human World, gefördert mit Mitteln der Stadt Wien.
Startseite des KINOSALON-Blogs – KINOSALON auf Facebook – Filmprogramm des KINOSALONS